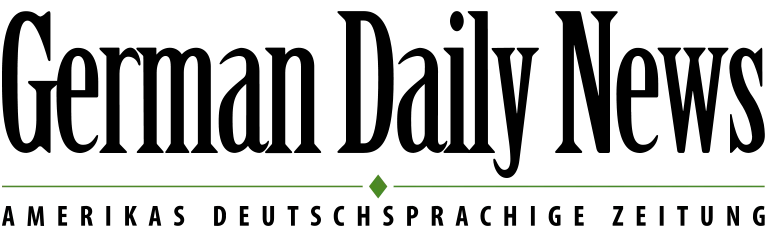Finanzen
Studie: Minijob ist ein Risiko im Lebenslauf
GDN -
Die meisten Frauen, die nur einen oder mehrere Minijobs haben, kommen aus dieser Erwerbsform nicht mehr heraus. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums.
Demnach wird ein Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umso unwahrscheinlicher, "je länger der Minijob währt", berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Montags-Ausgabe). Laut der Untersuchung sind Frauen, bei denen ihr Minijob keine zusätzliche Nebenbeschäftigung ist, im Durchschnitt bereits sechs Jahre und sieben Monate geringfügig beschäftigt, bei Verheirateten sind es sogar sieben Jahre und einen Monat. Nur 14 Prozent der Frauen, die früher einen Minijob als Hauptbeschäftigung ausübten, hätten heute eine Vollzeitstelle, 26 Prozent eine Teilzeitstelle mit mindestens 20 Stunden pro Woche. Mehr als die Hälfte der früheren Minijobber sei nicht mehr am Arbeitsmarkt tätig. Dies belege, dass Minijobs - anders als von den rot-grünen Arbeitsmarktreformern gewollt - "nicht als Brücke in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wirken". Minijobs als Haupterwerb seien im Effekt "ein Programm zur Erzeugung lebenslanger ökonomischer Ohnmacht und Abhängigkeit von Frauen". Autor der Analyse, die das Ministerium bislang unbemerkt von einem breiteren Publikum auf seiner Homepage veröffentlicht hat, ist laut SZ Professor Carsten Wippermann vom Delta-Institut für Sozial- und Ökologieforschung. Seine Studie beruht auf einer Befragung von mehr als 2000 Frauen. Etwa die Hälfte von ihnen hat einen Minijob, die andere Hälfte übte früher einen aus. Aus der Studie geht hervor, dass gut 60 Prozent der geringfügig beschäftigten Frauen ausschließlich einen Minijob haben. 84 Prozent von ihnen sind verheiratet. Für diese Ehefrauen sei der Minijob "mit erheblichen Risiken im Lebenslauf verbunden", schreibt Wippermann. Auf den ersten Blick erscheine ihnen so eine Stelle wegen ihrer Flexibilität und des steuerfreien Verdiensts attraktiv. Die Minijobs hätten auf Dauer aber ein negatives Image. Obwohl die allermeisten eine berufliche Ausbildung vorweisen können, würden solche Frauen nicht mehr als qualifizierte Fachkraft gelten. Die Hürde zu einer regulären Teilzeit- oder Vollzeitstelle werde erst "durch den Minijob pur errichtet beziehungsweise massiv erhöht". Solche Frauen hätten "künftig kaum die Möglichkeit, im Fall von Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Tod des Partners die finanzielle Existenzsicherung ihrer Familie und ihrer selbst zu erwirtschaften" sowie für ihre Alterssicherung ausreichend zu sorgen. Das von den Politikern geschaffene Anreizsystem sei deshalb "kontraproduktiv". Auch ein anderer Wunsch der Reformer, die Bekämpfung der Schwarzarbeit, habe sich nicht erfüllt. 85 Prozent der befragten Frauen bestreiten nicht, dass Schwarzarbeit bei Minijobs vorkommt. 32 Prozent gaben an, dass sie gang und gäbe sei, also Beträge über den Minijob-Lohn bar ausgezahlt werden, wenn entsprechend mehr gearbeitet wird. Wippermann schreibt dazu: Schwarzarbeit gelte unter den Minijobbern als "Ausweis von Engagement, Flexibilität und Vertrautheit mit dem Arbeitgeber - und ist nahezu eine soziale Norm: Wer diese nicht nutzt oder sich dieser gar verweigert, ist dumm oder verdächtig". Legale soziale Normen werden dagegen nicht erfüllt: Obwohl die Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, erhielten 77 Prozent der Frauen im Minijob pur kein Urlaubsgeld, knapp die Hälfte keine Lohnfortzahlung bei Krankheit. Die Mehrheit der Frauen sieht diese Arbeit trotzdem positiv. Mehr als 80 Prozent gaben an, diese sei für sie keine "Sackgasse". Wippermann merkt dazu an: Während des Minijobs "dominieren die Anreizsysteme und die optimistische Erwartung, eine reguläre Stelle gemäß der eigenen Qualifikationen bekommen zu können. Doch dies erweist sich als (Selbst-)Täuschung und Schimäre".
Für den Artikel ist der Verfasser verantwortlich, dem auch das Urheberrecht obliegt. Redaktionelle Inhalte von GDN können auf anderen Webseiten zitiert werden, wenn das Zitat maximal 5% des Gesamt-Textes ausmacht, als solches gekennzeichnet ist und die Quelle benannt (verlinkt) wird.